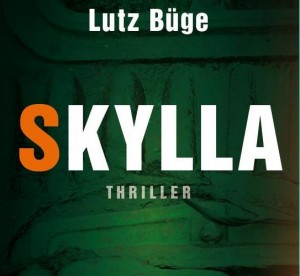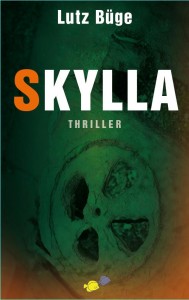 In etwa zwei Monaten ist es so weit: Skylla erscheint, die Fortsetzung von Virenkrieg, der zweite von fünf Teilen des Virenkrieg-Zyklus‘ von Thriller-Autor Lutz Büge. Hochbrisant geht es weiter mit dem Ritt auf der Schneide der Rasierklinge. Titelgebend ist Skylla, ein genmanipuliertes Virus, das als zweite Stufe eines Biowaffensystems politische Attentate mit einer Präzision ermöglicht, die kein Scharfschütze hinbekommt.
In etwa zwei Monaten ist es so weit: Skylla erscheint, die Fortsetzung von Virenkrieg, der zweite von fünf Teilen des Virenkrieg-Zyklus‘ von Thriller-Autor Lutz Büge. Hochbrisant geht es weiter mit dem Ritt auf der Schneide der Rasierklinge. Titelgebend ist Skylla, ein genmanipuliertes Virus, das als zweite Stufe eines Biowaffensystems politische Attentate mit einer Präzision ermöglicht, die kein Scharfschütze hinbekommt.
Mehr über Skylla vorab: –> HIER.
Nach rund zwei Jahren Arbeit kann ich sagen: Skylla ist ein richtiger Schmöker geworden. Es gibt wieder drei Handlungsstränge. Einer davon ist erst spät hinzugekommen. Ursprünglich war etwas völlig anderes an dieser Stelle vorgesehen: Ich wollte die Geschichte von Christopher Spark erzählen, Steward an Bord der Queen Mary 2. Diese Geschichte entfällt in der Endfassung von Skylla, die demnächst erscheint. Ich bringe einen Teil davon auf Ybersinn.de als kleinen Appetithappen mit dem Hintergedanken im Kopf, irgendwann vielleicht einen eigenen Roman daraus zu machen.
.
Entfallene Szene aus Skylla – Virenkrieg II
14. Juni 2024, ca. 20 Uhr
New York, Liberty Island
Lieber als pdf-Dokument? –> HIER.
.
Christopher Spark hielt sich krampfhaft am Tischbein fest und dachte unablässig:
Hoffentlich ist es bald vorbei, Herr im Himmel, mach, dass es bald vorbei ist!
Das Tischbein war fest mit dem Boden des Speisesaals verschraubt. So hatten es die Schiffskonstrukteure gewollt. Chris hatte sie oft genug dafür verflucht, weil es damit leider völlig unmöglich war, Tische zusammenzuschieben, wie die Gäste es manchmal wünschten, wenn sich lustige Gruppen gefunden hatten. Das kam auf Kreuzfahrten häufig genug vor, ja, für manche Menschen waren diese überraschenden Bekanntschaften sogar der wichtigste Grund, sich überhaupt auf eine Kreuzfahrt einzulassen, und nicht jeder hatte Verständnis oder gar einen Sinn dafür, dass in Speisesälen der Ersten Klasse an Bord eines Luxus-Kreuzfahrtschiffes wie der Queen Mary 2 ein gewisser Stil gepflegt werden musste. Für die Saufgelage gab es schließlich genügend Bars, Pubs und Diskotheken an Bord. Chris hasste es, den Gästen erklären zu müssen, dass ein Speisesaal nach der Definition der Konstrukteure der Queen Mary 2 in erster Linie ein Ort gesitteter Nahrungsaufnahme war, wo gruppendynamische Prozesse nur unter Wahrung von Stil und Anstand gestattet waren. Er hätte es nicht für möglich gehalten, dass er die Konstrukteure jemals für ihre grundsolide Planung loben würde. Doch jetzt, nachdem das Tischbein sein einziger Halt im Leben geworden war, dachte er anders über die Prinzipienreiterei dieser Leute.
Der Boden zitterte und bebte und wurde in unregelmäßigen Abständen von schweren Stoßwellen durchlaufen, und mit ihm der Tisch und Chris und alle Menschen im Saal, die bei jedem Stoß angstvoll aufschrien. Dazu drang ein Kreischen und Quietschen aus der Tiefe der Queen Mary 2 herauf, als schramme der Kiel des Schiffes über Grund.
Lang ausgestreckt lag Chris unter dem Tisch, an dem er seit Jahren Essen aufgetragen, Getränke eingeschenkt und die Gäste nach ihren Wünschen gefragt hatte, an diesem wie an den anderen Tischen des Speisesaals. Er hatte diese Arbeit geliebt und sie mit Würde und Stil erledigt. Es war nicht immer einfach gewesen mit den Gästen, oh nein; manche Gäste hätte er am liebsten eigenhändig hinausbefördert und über die Reling geworfen. Doch er hatte stets Haltung bewahrt, und niemand konnte sich über ihn beschweren. Doch jetzt war es vorbei mit seiner Haltung. Die Menschen um ihn her schrien, Kinder weinten und riefen nach ihren Eltern. Wenn im Film jemand derart schrie wie die Frau dort vorn, die mit einer Hand ihr vielleicht achtjähriges Kind festhielt und sich mit der anderen an eines der Tischbeine klammerte, dann musste Chris normalerweise das Kino verlassen. Hier jedoch konnte er nicht einfach weggehen oder sich auch nur die Ohren zuhalten. Er brauchte beide Hände, um sich festzuhalten. Allein der Gedanke, aufzustehen und zu versuchen, auf diesem Boden, der schwankte und bockte wie bei einem schweren Erdbeben, das Gleichgewicht zu bewahren, verursachte ihm Übelkeit.
Er selbst schrie auch, er hörte sich, aber es war völlig sinnlos. Es änderte nichts. Das Schiff bebte und ächzte in allen seinen Schweißnähten, während es seine Bocksprünge vollführte. Mit Höchstgeschwindigkeit war die Queen Mary 2 in die New York Bay hinein gerauscht. Chris gehörte lange genug zur Besatzung und war diese Strecke oft genug gefahren, um zu wissen, dass Bay Ridge nicht mit einem solchen Tempo an ihnen vorbeifliegen dürfte. Auch hatte er im Lauf der Jahre gelernt, die Arbeitsgeräusche der Maschinen einzuschätzen. In Küstengewässern waren acht bis zehn Knoten üblich, doch als sie in die Bay einlief, war die Queen Mary 2 mit Höchstgeschwindigkeit gefahren, mit 32 Knoten. Und mit diesem Tempo war sie, ein stählerner Koloss mit einer Masse von 76.000 Tonnen, dann offenbar auf Grund gelaufen. Trotzdem schoben die Maschinen sie weiter voran, immer weiter; daher die Erschütterungen, das Erdbeben. Nur so war das alles zu erklären. Aus den Tiefen des Schiffskörpers war ein zorniges, dumpfes Brummen zu hören, dann Krach, eine Explosion. Metall kreischte, und die Queen Mary 2 machte einen weiteren Satz.
Chris beglückwünschte sich dafür, dass er dem Rat der Terroristen gefolgt war und sich hingelegt und an dem Tischbein festgehalten hatte. Eine Minute vor der ersten Erschütterung hatten sie in einer schiffsweiten Durchsage angekündigt, dass es gleich „ein bisschen rumpeln“ werde. Genau so hatte der Sprecher es ausgedrückt, mit beinahe britischem Understatement. Nicht alle Menschen im Speisesaal hatten die Geistesgegenwart besessen, auf diese Empfehlung zu hören, obwohl Chris sie sogar noch dazu aufgefordert hatte. Er sah eine Frau, die auf dem Rücken liegend bei jedem Stoß, der durch das Schiff lief, angehoben und ein Stück nach vorn getragen wurde, Richtung Bug, während sie mit den Armen rund um sich herum nach Halt suchte. Sie hüpfte beinahe wie ein Flummi, schien dann in Chris ein vertrautes Gesicht zu entdecken, starrte ihn aus panisch aufgerissenen Augen an und schrie über das Chaos hinweg:
„Ich kann meine Beine nicht bewegen!“
Chris kannte die Frau. Er hatte sie in den vergangenen Tagen am Tisch bedient, aber ihr Name wollte ihm momentan nicht einfallen. Die Crew hatte auf Befehl des Kapitäns ihr Bestes gegeben, trotz der Entführung und trotz der Terroristen den Betrieb und den Anschein von Normalität mit allen Kräften aufrecht zu erhalten. Die Frau war mit den beiden Jungs an Bord, die Chris in sein Herz geschlossen hatte, dem kleinen, frechen und dem größeren, nachdenklichen. Ganz am Anfang war auch noch ein Mann bei ihnen gewesen, den dann allerdings die Terroristen gefangengenommen hatten. Sie hatten ihm den Prozess gemacht, weil er ein unsicheres Impfserum an afghanischen Häftlingen getestet haben sollte. Winter, so hieß der Mann, jetzt fiel es Chris wieder ein. Er hatte den Prozess verfolgt. Niemand in seinem Sektor hatte nach seinen Diensten verlangt, während die Terroristen ihr Tribunal-Theater aufgeführt hatten, alle Passagiere hatten vor den Bildschirmen gesessen und mit atemlosem Entsetzen verfolgt, was die Terroristen da veranstalteten. Für Chris war es ein durch und durch merkwürdiges Gefühl, dass er dieses Monstrum namens Winter beim Essen bedient hatte, aber wie sagte sein Freund Jeffrey doch immer:
„Solche Verbrecher sind üble Menschen, aber während sie essen, bringen sie wenigstens niemanden um.“
Jeffrey musste es wissen. Er hatte früher in einem italienischen Restaurant in Queens bedient, das stark von der Mafia frequentiert worden war.
Die Erschütterungen brachten Chris fast um den Verstand. Sie waren jetzt nicht mehr so stark, aber dafür kamen sie in schnellerer Folge. Dazu dieses ohrenbetäubende Quietschen und Kreischen von überlastetem Material, das den ganzen Schiffskörper erfüllte, dieses Zittern des Bodens, dieses Vibrieren des Tischbeins, an das sich Chris klammerte – Chris war mit den Nerven am Ende. Doch das Chaos kümmerte sich nicht darum, dass er nicht mehr konnte. Es machte einfach weiter, egal wie laut er schrie.
Es gab einen besonders heftigen Stoß, und mit lautem Klirren zersprangen Lampen und Fenster, Gläser rutschten von den Tischen. Chris fand sich in einem Regen von Glassplittern wieder. Teller und Besteck flogen durch die Luft. Chris zog seinen Kopf nicht schnell genug ein. Ein Teller traf ihn mit der Kante an der Stirn. Es war wie ein Glockenschlag. Ihm wurde schwarz vor Augen. Doch er durfte jetzt nicht bewusstlos werden! Sonst würde er den Halt verlieren und sich etwas brechen, wenn er den Gewalten ausgeliefert war wie Mrs. Winter, deren Schreie er hören konnte, obwohl sie inzwischen das vordere Ende des Speisesaals erreicht hatte.
Und dann war es plötzlich vorbei. Ein letzter Schlag, ein Bersten in der Tiefe des Hecks der Queen Mary 2, das die Decks anzuheben schien, ein letztes Schnauden des Schiffes, und urplötzlich war Stille, ohrenbetäubend nach diesem Inferno. Chris klammerte sich nur umso fester an das Tischbein.
Die Sekunden verstrichen, bis er begriff, dass es vorbei war, wirklich vorbei. Die Queen Mary 2 lag still. Ihre Maschinen arbeiteten nicht mehr. Trotzdem brannte das Licht; nicht alle Lampen waren zersprungen. Die Notstromaggregate schienen die Arbeit aufgenommen zu haben.
Vorsichtig ließ Chris das Tischbein los, dem er es mutmaßlich zu verdanken hatte, dass er dieses Chaos halbwegs unversehrt überstanden hatte, drehte sich herum und versuchte, auf die Beine zu kommen. Als er sich dabei am Boden aufstützte, fasste er in eine Glasscherbe. Fluchend stand er auf und starrte auf das Blut, das aus der Schnittwunde schoss.
Mal wieder auf den letzten Drücker, dachte er, typisch Christopher Spark.
Er nahm zwei Servietten von einem der Tische, presste sie auf die Wunde und ballte dann die Faust um die Servietten. Hoffentlich hörte es bald auf zu bluten.
Er blickte sich um. Was für ein Chaos! Umgefallene Stühle, Scherben, zersplitterte Fenster, weinende Kinder, Menschen, die auf die Beine zu kommen versuchten. Jenseits der Fenster war Lower Manhattan im Abendlicht zu sehen. Der vertraute Anblick traf Chris völlig unvorbereitet, und für einen Moment verspürte er den Impuls, durch die zersplitterten Fenster hinaus auf die Galerie zu steigen, über die Reling ins Meer zu springen und hinüberzuschwimmen nach Manhattan. Doch dann kratzte ihn etwas am Hals.
Er tastete danach und hielt kurz darauf eine weitere Glasscherbe in der Hand, die zwischen die Haut seines Halses und seinen Hemdkragen geraten war und ihm anscheinend Schnittwunden zugefügt hatte; jedenfalls hatte er Blut an den Fingern.
Da hob er beide Arme und rief:
„Meine Damen und Herren, achten Sie bitte darauf, wohin Sie fassen und wohin Sie treten. Überall sind Glasscherben. Die können schwere Verletzungen auslösen.“ Er sah sich um. „Roy? Roy Dunstan? Bist du hier irgendwo?“
Seine Suche nach dem Chefsteward des Erste-Klasse-Casinos war rasch von Erfolg gekrönt. Roy Dunstan hatte ein paar Sekunden gebraucht, um wieder zu sich zu kommen. Auch er war von einem herumfliegenden Gegenstand getroffen worden, anders als Chris jedoch an den Hinterkopf. Er war ein paar Sekunden bewusstlos gewesen. Abgesehen von der Beule schien es ihm aber gut zu gehen.
„Das muss ganz schnell genäht werden“, sagte er mit einem Blick auf Chris‘ Stirn.
Chris tastete dorthin, wo ihn vorhin der Teller getroffen hatte, und betrachtete interessiert das Blut an seinen Fingern.
„Ja, fass auch noch rein“, rügte sein Chef. „Tölpel!“
Ja, das war er – ein Tölpel. Manchmal.
Es tat nicht einmal weh.
„Haben wir noch weitere Verletzte?“, rief Roy. Er schien entschlossen, seine Rolle als Chef des Casinos auszufüllen und halbwegs Ordnung in das Chaos zu bringen, aber Chris sah, dass es ihm nicht gut ging. Roy war bleich, sehr bleich, und die Beule an seinem Hinterkopf war wirklich enorm.
„Wir brauchen die Sanitäter hier oben“, stellte er fest. „Chris, versuch mal, ob du das Krankenhaus via Bordtelefon erreichen kannst. Hat jemand eine Ahnung, wo die Terroristen abgeblieben sind?“
„Roy …“, sagte Chris.
„Was ist?“
„Setz dich lieber hin“, antwortete Chris, als er sah, dass Roy zu schwanken begann. Der Chef blickte Chris irritiert an und öffnete den Mund, um zu einer scharfen Entgegnung anzuheben, doch da knickten seine Knie ein. Chris war gerade noch schnell genug bei ihm, um zu verhindern, dass er mit dem Kopf aufschlug.
Ein weiterer Mann kniete neben ihnen zu Boden, öffnete Roys rechtes Augenlid und seufzte dann.
„Das sieht nicht gut aus“, sagte er. „Hirnblutung, würde ich sagen. Der Mann ist ins Koma gefallen.“
„Sind Sie Arzt?“, fragte Chris entsetzt.
„Chirurg. Vor fünf Jahren zur Ruhe gesetzt.“
„Eben läuft er noch bei vollem Verstand hier herum und gibt Befehle, und dann …“
„Der Schock“, sagte der Chirurg. „Sie haben auch einen, wetten? Die Wunde an Ihrer Stirn müsste eigentlich ziemlich schmerzen, aber vermutlich spüren Sie gar nichts – oder?“
Chris nickte.
„Krankenhaus“, sagte er dann und erhob sich, um zum Bordtelefon zu gehen. Das Krankenhaus der Queen Mary 2 befand sich nicht in diesem Sektor des Schiffes, aber vielleicht galt die Sache mit den Sektoren jetzt nicht mehr. In diese Sektoren war die Queen Mary 2 vor ein paar Tagen von den Terroristen eingeteilt worden. Keiner der Passagiere hatten den ihm zugewiesenen Sektor verlassen dürfen. Doch von den Terroristen hatte Chris jetzt schon seit Stunden keinen mehr gesehen.
Er schrak zusammen, als es plötzlich von überall her laut knackte. Dann dröhnte eine Lautsprecherstimme durch das Schiff.
„Meine Damen und Herren“, knarrte sie mit starkem arabischem Akzent, „die Queen Mary 2 hat New York City erreicht, das Ziel ihrer letzten Reise. Verhalten Sie sich ruhig! Dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir alle zusammen die nächsten Tage lebend überstehen. Zu Ihrer Information möchten wir darauf hinweisen, dass an Bord genug Sprengstoff verteilt wurde, um das Schiff in handtellergroße Stücke zu reißen. Außerdem haben wir alle Außenbereiche des Schiffes mit einer biologischen Waffe namens Anthrax kontaminiert. Sie löst eine Krankheit namens Milzbrand aus, die unheilbar ist. Wer sich damit ansteckt, stirbt einen qualvollen Tod. Achten Sie also die Grenzen der Ihnen zugeteilten Sektoren. Verhalten Sie sich angemessen und zivilisiert. Sie alle haben Zugang zu ausreichend Wasser, Nahrung, Toiletten und Schlafstätten. Ihre Mobiltelefone sind weiterhin nutzlos. In Kürze werden wir unsere Forderungen an die US-Regierung stellen. Wir hoffen, dass das alles gut für Sie ausgeht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“
 Neu: Virenkrieg I.
Neu: Virenkrieg I.
Thriller von Lutz Büge (Printausgabe)
„Verehrte Herren, lassen Sie mich nun zum Punkt kommen. Welche Kriterien zeichnen ein echtes Killervirus aus? Ich glaube, es sind vier:
Erstens: Hohes Ansteckungspotenzial. Es kann leicht übertragen werden. Unübertroffen ansteckend ist das Pocken-Virus, aber auch Influenza-Viren wie H5N1 können das gut.
Zweitens: Hohe Sterbequote mit dem Potenzial, selbst das beste Gesundheitssystem zum Zusammenbruch zu bringen. Unübertroffen: das Marburg-Virus mit bis zu 90 Prozent Toten.
Drittens: Mieses Image. Unser Killervirus löst Panik aus und lässt das gesellschaftliche Zusammenleben zum Erliegen kommen.
Viertens: Kein Gegenmittel. Es steht kein Impfstoff zur Verfügung und es kann in der Eile auch keiner hergestellt werden. Im Idealfall sollte es sich also um ein unbekanntes Virus handeln, das noch nicht erforscht werden konnte.
Und damit kommen wir zum Kern dieser Veranstaltung, sehr geehrte Herren, denn ich hätte hier etwas für Sie, hier in diesem kleinen, unscheinbaren Hochsicherheitsbehälter …“
Auszug aus den SCOUT-Protokollen, März 2017
Böse? Das war erst der Anfang. Mehr gibt es –> HIER.
Virenkrieg – Erstes Buch. Roman. Ybersinn-Verlag Offenbach. Paperback.
440 Seiten. 14,90 €. ISBN: 9783981738803.
Im Buchhandel oder direkt beim Ybersinn-Verlag –> HIER.
Das E-Book gibt es für 9,99 € in allen gängigen Online-Shops. ISBN 9783844292503.
Oder in unserem Freund-Shop Epubli.de: –> HIER.
Von Lutz Büge stammen diese Bücher und E-Books:
+++ Facebook +++ Twitter +++ News +++ Ybersinn-Verlag +++ Shop +++ HOME +++